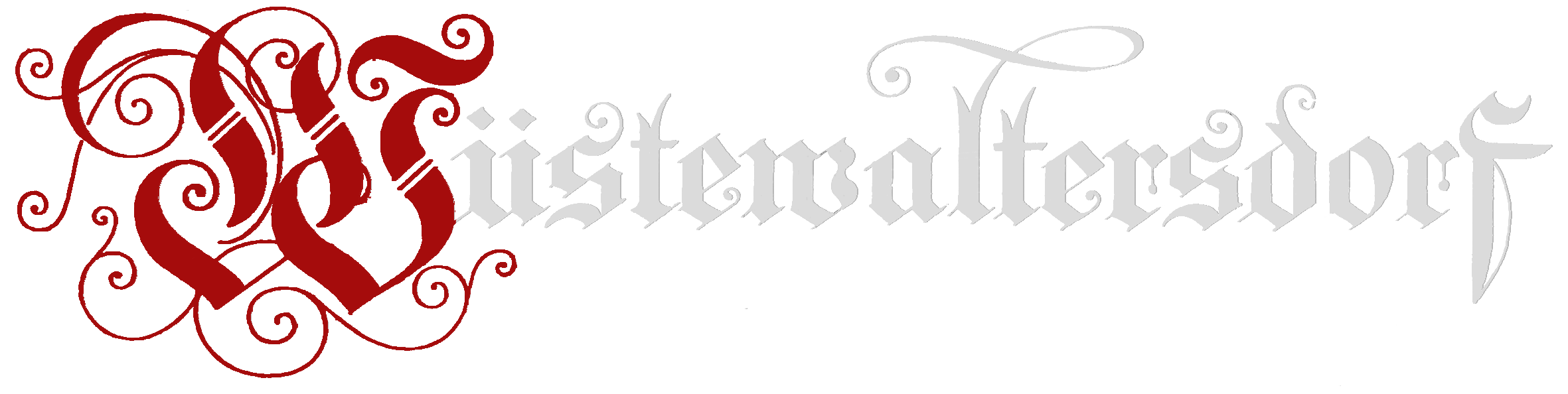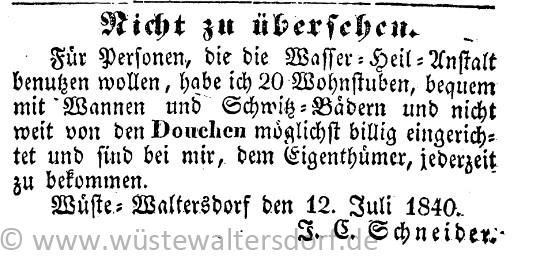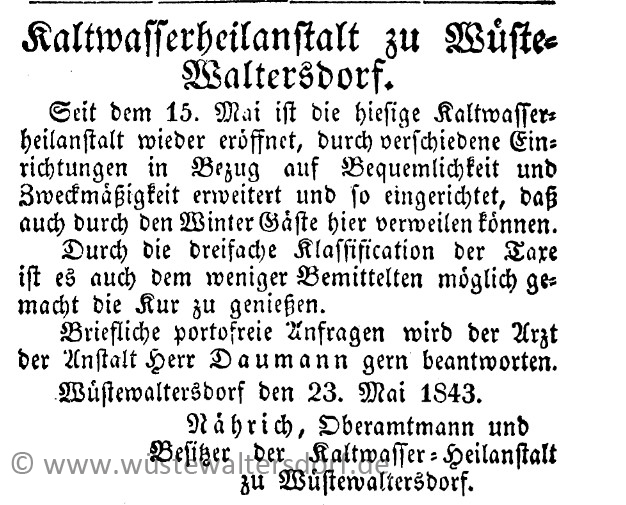Dorfleben:
Das Leben im Dorf - Wasserheilanstalten in Wüstewaltersdorf
Erste Anfänge Wüstewaltersdorf touristisch zu entwickeln gab es Mitte des 19. Jahrhunderts. Darüber berichtet Max Kleinwächter im "Schlesischen Bergland Kalender" von 1941:
Als Wüstewaltersdorf Kurort werden sollte
"Wem ist es wohl noch bekannt, daß Wüstewaltersdorf nach dem Niedergang seines einst so blühenden Leinenhandels auf dem Weg war, Kurort zu werden? Dr. Richard Gottwald läßt sich in seinem ortsgeschichtlichen „Das alte Wüstewaltersdorf" nur ganz kurz darüber aus, und doch scheint es angebracht, sich dieser Bemühungen, wieder Suche erhöhtes wirtschaftliches Leben in den Ort zu bringen, zu erinnern, zumal sie gerade 100 Jahre zurückliegen. Ohne Zweifel hätte sich das landschaftlich reizvoll liegende Dorf mit seinen stilgerechten Bauten für einen Kurort ausgezeichnet geeignet. Das hatte wohl der Kaufmann Christian Schneider aus Wüstewaltersdorf erkannt, der anscheinend ein Anhänger des damals aufkommenden Prießnitzschen Wasserheilverfahrens war. Er errichtete 1839 in seinem Bauerngut Nr. 93 eine Kaltwasserheilanstalt und übergab sie der Leitung des Dr. Senftner aus Breslau.
Im Sommer 1840 umfaßte diese Anstalt laut einer Anzeige der in Waldenburg erscheinenden „Schlesischen Gebirgs-Blüthen" 20 Wohnstuben für Kurgäste, bequem liegende Wannen und Schwitzbäder und nicht weit davon mehrere „Douchen". Ausführlicheres über das Schneidersche Kaltwasserbad erfahren wir aus einer Anzeige in demselben Blatt vom 22. März 1841.
„Vor zwei Jahren", so berichtet Schneider, errichtete ich hier auf einem mir gehörigen Berge eine Wasserheilanstalt und legte in dem daran stoßenden Wäldchen (hinter Wilhelmstal) Douchen an. Nachdem sich nun diese Anstalt einer steigenden Teilnahme erfreut hat, so hatte ich auch die mir gemachten Vorschläge zu Verbesserungen in diesem Jahre in Ausführung gebracht und nicht allein die wohnlichen Räume vergrößert, sondern sie auch durch innere Ausschmückung angenehmer gemacht. Für Bespeisung der Kurgäste wird ein besonders dazu angestellter Traiteur sorgen.
Der Leiter der Anstalt ist Arzt Treutler aus Wüstewaltersdorf unter der Aufsicht des in diesem Fach durch seine Leistung rühmlichst bekannten Herrn Dr. Bürdner, Direktor der Wasserheilanstalt Altscheitnig bei Breslau.“
Dr. Senftner, von dem wir hier nichts mehr hören, hatte sich schon nach kurzer Zeit von Schneider getrennt und zu dessen größtem Verdruß in unmittelbarer Nähe seiner Anstalt eine eigene Heilanstalt eröffnet. Dass es dabei zu unerquicklichen Reibereien zwischen den beiden Unternehmern gekommen ist, lässt eine Anzeige Dr. Senftners vom 29. März 1841 erkennen. "Meine Kaltwasserheilanstalt", so liest man hier, "ist ohne Unterbrechung geöffnet. Durch den günstigen Umstand, dass der Königl. Landrat Graf von Bieten seit kurzem Besitzer der Herrschaft geworden ist, bin ich in der Lage, die benötigten Douchen an den kältesten, reichsten und ausdauerndsten Gießbächen aufzustellen, wodurch fortan jede Kollision meiner geehrten Kurgäste mit einem anderen Herrn Douche Besitzer vermieden wird."
Welche Aufmerksamkeit das Wüstewaltersdorfer Wasserbad bei der Berglandbevölkerung auf sich zog, beweist das mundartliche Gedicht in den „Gebirgs Blüthen" vom Jahre 1840: „Dos Wosserbod zu Wüstewalterschdurf", von Karl Moritz, dem wir folgende heitere Strophen entnehmen.
Den Wasserbädern aber sollte nur ein kurzes Dasein beschieden sein. Waren es die Unstimmigkeiten der beiden Besitzer oder fehlte es beiden an den nötigen Mitteln, die Anstalten weiter auszubauen oder lagen andere Gründe vor, daß schon 1845 Wüstewaltersdorf den Traum als werdender Kurort aus geträumt hatte? Die Antwort darauf liegt im Dunkeln."
Soweit der Artikel von Max Kleinwächter. Der Vollständigkeithalber sei erwähnt, daß 1843 eine weitere Anzeige in den „Schlesischen Gebirgs-Blüthen" erschien, in denen ein Herr Nährich Werbung für eine am 15. Mai 1843 wieder eröffnete Kaltwasserheilanstalt macht. Welchen der beiden oben beschriebenen diese zuzuordnen ist, ist unklar. Auch wie es mit den Kuranstalten weiterging.
Quelle: „Schlesischer Bergland Kalender 1941“, aus der digitalen Bibliothek https://jbc.jelenia-gora.pl
Artikel aus „Schlesische Gebirgs-Bluethen“, verschiedene Ausgaben, aus der digitalen Bibliothek:
https://www.bibliotekacyfrowa.pl