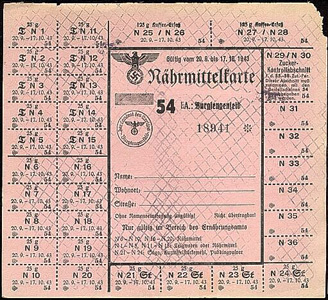1. Das Leben im Dorf während des Krieges
Bericht einer Zeitzeugin:
Schon bald nach dem siegreichen Einmarsch in Frankreich bekamen wir die ersten französischen Kriegsgefangenen. Es waren so um die 30 Männer und 3 bis 4 junge Frauen. Untergebracht waren die Männer im Hause der Kohlmann Trudel. Die Mädchen wohnten, soweit ich mich erinnern kann, im Knillmann (Fleischer) Haus. Da wir im Kohlmannhaus auch unsere Geschäftsräume hatten, blieb ein gewisser, freundlicher Kontakt zu den Franzosen nicht aus. Man grüßte sich und wir steckten ihnen schon mal etwas zu. Die Männer arbeiteten in der Firma, die Mädchen in der Näherei bei Herrn T.. Einige der Franzosen waren auch beim Bauern eingesetzt. Ich meine mit Recht sagen zu können, dass diese Kriegsgefangenen bei uns ein relativ gutes Leben hatten und keiner in ihnen einen Feind sah.
Eines der Mädchen bekam einen kleinen Jungen, der mit Hilfe freundlicher Nachbarn aufgezogen wurde und den sein Vater nach Kriegsende voller Stolz mit in seine Heimat nahm. Das junge Mädchen starb bald nach der Geburt des Kindes an Tuberkulose. Ich erinnere mich an den Todesfall der so jungen Mutter des Kindes insofern, als meine Mutter eines ihrer besten Nachthemden dem toten Mädchen im Sarg angezogen hat. Das brachte uns natürlich große Dankbarkeit ein. Ich greife hier vor, will nur sagen, dass, nachdem die Russen in unser Dorf einfielen, 2 Franzosen einige Nächte bei uns geschlafen haben, um uns Schutz vor der furchtbaren Gewalt der Russen zu geben. Leider kamen die Franzosen sehr schnell nach Kriegsende in ihre Heimat.
Ein große Wende in vielen Bereichen unseres täglichen Lebens trat ein, als 1941 der Krieg in Russland begann, da kamen auch sehr bald die ersten Meldungen unserer Gefallenen oder vermissten Jungen und Männer. Man trauerte mit den Angehörigen, doch das Leben lief weiter. - Schon Ende 1941 kamen die ersten russischen Kriegsgefangenen in unser Dorf. 1942 waren es sicher an die tausend Mann, doch das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Sie waren untergebracht in der Oberweberei, wurden dort auch verpflegt. Täglich zur gleichen Zeit zogen diese Männer, begleitet von den Wachposten der OT (Organisation Todt- die nichtwehrfähige Männer für diese Zwecke einstellten) an unserem Haus (Lützwitzvilla, Gartenstraße) vorbei; Männer in dicken wattierten Jacken, ebensolchen Stiefeln und Mützen, aber völlig unterernährt. Immer fielen welche um, wurden von den Kameraden wieder hochgerissen und weitergeschleppt.
Durch einen Zufall, den eine nichtansässige Person aufdeckte, stellte man fest, dass der größte Teil der für die Versorgung der Gefangenen auszugebenden Lebensmittel in die Taschen der für diesen Bereich Verantwortlichen gelangte. Danach bekamen die Gefangenen die ihnen zustehenden Lebensmittel und es ging ihnen etwas besser; sie wurden nicht dick, aber sie wurden ausreichend versorgt.
Wo die russischen Gefangenen arbeiteten, haben wir eigentlich lange nicht erfahren. Sie wurden hinterm Bahnhof in Richtung Wolfsberg getrieben und verschwanden damit aus unserem Blickfeld. Im Dorf wurde gemunkelt, man wolle bei uns ein neues Führerhauptquartier bauen, wozu unsere Gegend sicher auch sehr geeignet war, mit den Bergen und den riesigen Wäldern.
Täglich hörten wir die Fanfarenklänge aus unserem Volkssender, die immer neue Siege ankündigten, neue Versenkungen feindlicher großer Schiffe durch unsere U-Boote, Zerstörer etc. Wir waren nur auf "Sieg" eingestellt. Es bestand auch keine Möglichkeit das zu erfahren, was da wirklich geschah. Der Krieg war für uns immer noch weit weg, es gab da nur die Trauer, um immer mehr Gefallene oder Vermisste und eben die Anwesenheit der russischen Kriegsgefangenen.
Im Frühjahr 1943 sah ich zufällig, wie ein Güterzug im Bahnhof einlief und Hunderte komischer Gestalten entladen wurden. Gestreifte Anzüge und ebensolche Kappen. Sie wurden sofort hinterm Bahnhof den Berg hinaufgeführt, ebenfalls Richtung Uhlen- und Wolfsberg. Wer diese Menschen waren, was sie bei uns taten, es dauerte einige Wochen, bis wir dahinter kamen.
Inzwischen bekamen wir Bombenflüchtlinge und durch sie erfuhren wir, was sich da in den Großstädten tat. Amerikaner und Engländer bombardierten in immer kürzeren Abständen unsere Großstädte, es gab unendliche Verluste an Gebäuden, aber vor allem an Menschen. Man begann Frauen und Kinder zu evakuieren, und da Schlesien der Luftschutzkeller Deutschlands war, hatten auch wir Menschen aufzunehmen. Diese Menschen aus Hamburg, Köln oder Berlin waren sehr bald bei uns heimisch, sie waren anständig untergebracht und lebten nun wieder in einer friedlichen Welt, wo sie nachts ruhig schlafen konnten.
Im Sommer 1943 erschienen auf einmal die Menschen in ihren gestreiften Anzügen im Dorf. Sie begannen Gräben an der Hauptstraße auszuschachten, um Kabel zu verlegen; das auch auf der Gartenstraße. Über ein Brett liefen wir aus unserem Gang auf die Gartenstraße, im Graben darunter schachteten die Männer, unter ihnen auch Jungens, fast Kinder. Abgemagert bis auf die Knochen, ohne ausreichende Bekleidung. Im Herbst und Winter wickelten sie sich in Zementsäcke. Jetzt erfuhren wir, dass es sich bei diesen Menschen um Juden handelte; Juden aus aller Herren Länder. Der Anblick dieser armen, geschundenen und oft zu Tode gequälten Menschen hat bei uns im Dorf große Anteilnahme ausgelöst. Wir, aus unserem Haus haben so oft es ging (man musste immer die OT-Posten oder Kapos - von den Juden ausgewählte Bewacher - im Blickfeld haben) Bekleidung, Socken, Unter- und Oberwäsche und vor allem Brot in den Graben geworfen. Als die Juden auf der Dorfstraße schachteten, habe ich lange Zeit einen Jungen, der sicher nicht älter als 14 Jahre war, mit Roggenbrötchen versorgt, die ich beim Bäcker John regelmäßig am Vormittag zur bestimmten Zeit einholte.
In welcher Gefahr man dabei stand, habe ich damals nicht gewusst, denn wir hatten nun auch die Geheime Staatspolizei im Ort, die in Zivil liefen, also man wusste nie, ob man beobachtet wurde. Ich kann hier auch der Meinung entschieden entgegentreten, die man uns nach dem Krieg immer wieder vorgehalten hat, wir hätten um die Juden, die Konzentrationslager und was dort geschah, gewusst. Nein, wir wussten es nicht, woher auch, denn wir hörten nur das, was die Regierung für wichtig hielt. Wir hörten alle Nachrichten so, dass wir gar nicht wissen konnten, was derweil im Krieg geschah, in Russland, in den besetzten Gebieten.
Wir hatten am Montagabend immer Chorprobe des Kirchenchores, Herr Rektor K. war noch nicht Soldat. An einem solchen Montagabend kurz vor 8 Uhr ging ich mit Frau C., wir wohnten zusammen, zur Probe. Die Stengelbrücke war mit Scheinwerfern taghell ausgeleuchtet, im eiskalten Gebirgsbach gegenüber vom Schremmer Häusel standen die Juden und arbeiteten, es war der Monat November und wir Wüstewaltersdorfer wissen, dass dieser Monat schon - Winter - war. Ich sagte zu Frau C.: Gnade uns, wenn sich das Rad mal dreht. Nie vergesse ich diesen Abend und meine Reaktion.
Wenn die russischen Gefangenen am Spätnachmittag von ihrer Arbeit zurückkamen, verschwanden Dutzende in den anliegenden Häusern und erbettelten Zwiebeln und Kartoffeln; wir haben alle gegeben. Die Bewachung war nicht mehr zu streng, wo hätten diese Menschen denn auch hingesollt. Es gab noch einmal eine Fleckfieberepidemie, an der sehr viele Gefangene zu Tode kamen. Das ganze Dorf wurde geimpft und soweit mit bekannt ist, ist keiner von uns Einheimischen schwer erkrankt oder gar gestorben.
Im Januar 1945 kamen die Frauen von der NSV im Auftrage der Partei, um Mütter mit Babys und Kleinkindern zu evakuieren. Ich konnte und wollte meiner Mutter und Schwester wegen nicht fort, hatte auch meinem Vater, der noch Soldat geworden war, das Versprechen gegeben, nie ohne meine Mutter wegzugehen. Einige meiner Freunde haben der Aufforderung Folge geleistet und sind dadurch der schrecklichsten Zeit unseres Lebens, die nach dem Krieg für uns kam, entgangen. Sie kamen in warmen Zügen aus Schlesien heraus, man konnte es keinem verdenken, der diese Chance wahrnahm.
Danach kursierten Gerüchte, das Dorf soll evakuiert werden, aber wohin denn noch, der einzige schmale freie Durchgang wäre die Tschechoslowakei gewesen. Bevor es soweit kam, war auch da nicht mehr durchzukommen und wir blieben. Was da auf uns zukam mit dem Kriegsende hat sich wohl keiner so schrecklich vorgestellt. Man hörte Erlebnisberichte, die von den furchtbaren Gräueltaten der Russen sprachen, doch wir glaubten, wenn der Krieg vorbei ist, dann ist auch das vorbei. In einer eiskalten Nacht im Januar 1945 wurden wir herausgeklingelt, im Flur vor unserer Wohnung standen 1/2 Dutzend Menschen, dick vermummt. Es waren Flüchtlinge, die mit Pferd und Wagen aus Ostpreußen bis zu uns gefunden hatten. Wir mussten eine Familie aufnehmen; sie blieben nicht allzu lange, der Osten war ihnen nicht sicher genug. Danach kamen Menschen aus Breslau, die Stadt war seit Januar Festung, ich weiß nicht, wie viele Menschen in diesen letzten Kriegsmonaten bei uns im Dorf waren. ... <<